Wir müssen reden. Über Monoprotein.
Monoprotein im Fertigfutter oder beim Barfen gilt inzwischen fast als Gütesiegel. Ob auf der Dose, in Trockenfutter-Form oder in der Rohfütterung: „Monoprotein“ suggeriert Sicherheit und vermittelt das Gefühl. besonders hochwertig und verträglich zu füttern.
Aber senkt es wirklich das Risiko von Unverträglichkeiten? Und ist es überhaupt sinnvoll, strikt bei einer Tierart zu bleiben – oder ist es sogar notwendig? Wie immer lohnt sich ein genauer Blick. Denn nicht das Schlagwort „Monoprotein“ entscheidet, sondern die Zusammensetzung und die individuelle Situation deines Hundes oder deiner Katze.
Table of Contents
Was bedeutet „Monoprotein“ überhaupt?
Monoprotein bedeutet wörtlich: eine einzelne Proteinquelle. Im Zusammenhang mit Tiernahrung ist damit gemeint, dass alle enthaltenen tierischen Bestandteile von einer einzigen Tierart stammen. Eine Dose mit „Monoprotein Lamm“ enthält dann z. B. ausschließlich Lammfleisch, Lamminnereien und ggf. Lammfett. Aber eben kein Rind, kein Geflügel, keine weiteren tierischen Zutaten anderer Tierarten.
Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass Monoprotein-Füterung grundsätzlich besser verträglich ist oder seltener Allergien auslöst. Doch leider das stimmt so nicht.
Denn eine Unverträglichkeit oder allergische Reaktion kann sich prinzipiell gegen jeden Bestandteil eines Futters richten. Das betrifft also nicht nur das Fleisch bzw. alle tierischen Bestandteile, sondern auch Kohlenhydratquellen, Zusatzstoffe, Bindemittel oder Öle.
Monoprotein kann also dann hilfreich sein, wenn man bereits weiß, auf welche Proteinquelle der Hund oder die Katze reagiert oder wenn man in einer Ausschlussdiät systematisch nach dem Auslöser von Symptomen sucht.
Aber Achtung: Fertigfutter ist für eine Ausschlussdiät nicht oder nur bedingt geeignet.
Mehrere Monoprotein-Sorten = trotzdem bunt gemischt
Ein Denkfehler, der sich ebenfalls hartnäckig hält: Wer Monoprotein-Sorten abwechselt, füttert abwechslungsreich, aber „sauber“. Also z. B. am Montag rein Lamm, Dienstag nur Rind, Mittwoch alles von der Ziege, Donnerstag landet nur Huhn im Napf.
In der Praxis kommt das einer gemischten Fütterung gleich. Denn die Proteinvielfalt entsteht nicht erst in der Dose, sondern im Napf. Ob die verschiedenen Fleischsorten nun zusammen verarbeitet wurden oder in aufeinanderfolgenden Mahlzeiten verfüttert werden, macht erstmal keinen großen Unterschied.
Gerade bei Tieren, bei denen (noch) keine Futterunverträglichkeit bekannt ist, kann diese Praxis sogar kontraproduktiv sein. Denn je mehr Tierarten man regelmäßig füttert, desto schwieriger wird im Fall der Fälle die spätere Ursachenfindung bzw. die Suche nach einer verträglichen Proteinquelle.
Ein Plädoyer für weniger Vielfalt
Was viele nicht bedenken: Es ist meist deutlich hilfreicher, über längere Zeit bei wenigen, gut verträglichen Proteinquellen zu bleiben, als möglichst viele unterschiedliche Tierarten „auszuprobieren“. Nicht nur mit Blick auf mögliche Allergien, sondern auch in Bezug auf Darmgesundheit, Stoffwechselanpassung und Verdauungsenzyme.
Natürlich, wir sind es für uns selbst gewohnt, dass eine abwechslungsreiche Ernährung als wichtig angesehen wird. Das übertragen wir oft unbewusst auf Hund oder Katze. Je abwechslungsreicher, desto besser. Aber leider gilt das für Hund und Katze nicht in derselben Art und Weise wie für uns Menschen. Wenn man sich die natürliche Nahrung von Katzen, aber auch von Wölfen anschaut, dann stellt man fest, dass es da nicht viel Abwechslung gibt. Beide Tierarten sind spezialisierte Jäger, Katzen mehr, Wölfe weniger. Das, was sie jagen, hat die für sie ideale Zusammensetzung.
Diesen Grundgedanken sollten wir also für die Fütterung zugrunde legen: Es geht nicht so sehr um möglichst grosse Abwechslung mit gefühlt 100 verschiedenen Zutaten. Sondern das, was wir füttern, sollte möglichst so gestaltet sein, dass es so wenig Abwechslung wir möglich braucht. Und zwar, weil alle wichtigen Nährstoffe in der passenden Menge verfügbar sind.
Zuviel unterschiedliche Tierarten oder unterschiedliche Kombinationen unterschiedlicher Fertigfutter zu füttern, borgt vor allem bei Hunden auch das Risiko, dass die Verdauung nicht dauerhaft mitspielt. Denn auch der Verdauungstrakt muss sich immer ein wenig auf die Fütterung einstellen, wenn sie sehr unterschiedlich ist. Das betrifft allerdings nicht unterschiedliche Proteinquellen, sondern vor allem die Qualität und die Textur der gewählten Fütterung.
Wann Monoprotein wirklich sinnvoll ist
Trotzdem hat Monoprotein natürlich seine Berechtigung – und es gibt Situationen, in denen eine klare, einheitliche Eiweißquelle absolut empfehlenswert ist:
Allergien oder Unverträglichkeiten
Wenn bereits diagnostiziert wurde, dass das Tier auf bestimmte tierische Proteine reagiert, ist Monoprotein oft die einzige sinnvolle Option. In solchen Fällen hilft ein klar deklariertes Futter dabei, die bekannte Allergenquelle zuverlässig zu meiden.
Ausschlussdiät
In der Diagnostik von Futtermittelallergien oder-unverträglichkeiten sind Ausschlußdiäten der Goldstandard.
Dort ist Monoprotein unverzichtbar. Denn nur so lässt sich Schritt für Schritt überprüfen, auf welche Bestandteile das Tier reagiert – und welche es gut verträgt. Aber: Ausschlussdiäten sind normalerweise selbst gemachte Rationen, die so oder so nur eine einzelne Proteinquelle enthalten. Sollte zumindest so sein.
Welpen oder Junghunden / Kitten
Gerade im Wachstum ist es sinnvoll, mit einer überschaubaren Auswahl an Proteinquellen zu arbeiten. Nicht nur um das noch reifende Immunsystem nicht zu überfordern (Hallo Allergie!) , sondern auch, um im späteren Leben noch Rückgriff auf nicht eingeführte Proteinquellen zu haben – sollte es irgendwann nötig sein.
Umstellungsphasen
In Umstellungsphasen, beispielsweise von Fertigfutter auf BARF, nutzt man für die ersten Tage meistens nur eine Proteinquelle und ergänzt dann die Fütterung immer weiter um alle benötigten Bestandteile. Hierbei geht es darum, den Verdauungstrakt erst einmal an die neue Fütterung zu gewöhnen und das möglichst schonend. Auch wenn der Hund die Proteinquelle, die gefüttert wird, bereits kennt, braucht eine komplette Ernährungsumstellung immer auch Zeit. Konsistenz, Verhältnisse der Makronährstoffe zueinander, Fettgehalte, all das können Faktoren sein, die sich je nach Fütterungsart etwas unterscheiden. Daher reduziert man die Futterbestandteile erst einmal eine möglichst überschaubare Menge und dazu gehören eben auch die Proteinquellen.
Kein Qualitätskriterium!
So verlockend es manchmal klingt: Die Deklaration „Monoprotein“ ist kein Hinweis auf besonders gute oder reine Produkte. Es sagt nichts darüber aus, ob hochwertiges Muskelfleisch oder billige Nebenerzeugnisse verwendet wurden, ob die Tiere artgerecht gehalten wurden, oder ob die Ration bedarfsdeckend ist.
Auch beim Barfen ist Monoprotein keine Garantie für Qualität. Eine Ration aus reinem Rind kann ausgezeichnet oder völlig unausgewogen sein – je nachdem, wie sie zusammengestellt wurde. Ebenso kann ein Fertigfutter mit mehreren Proteinquellen hochwertiger sein als ein Monoprotein-Produkt mit zweifelhafter Deklaration.
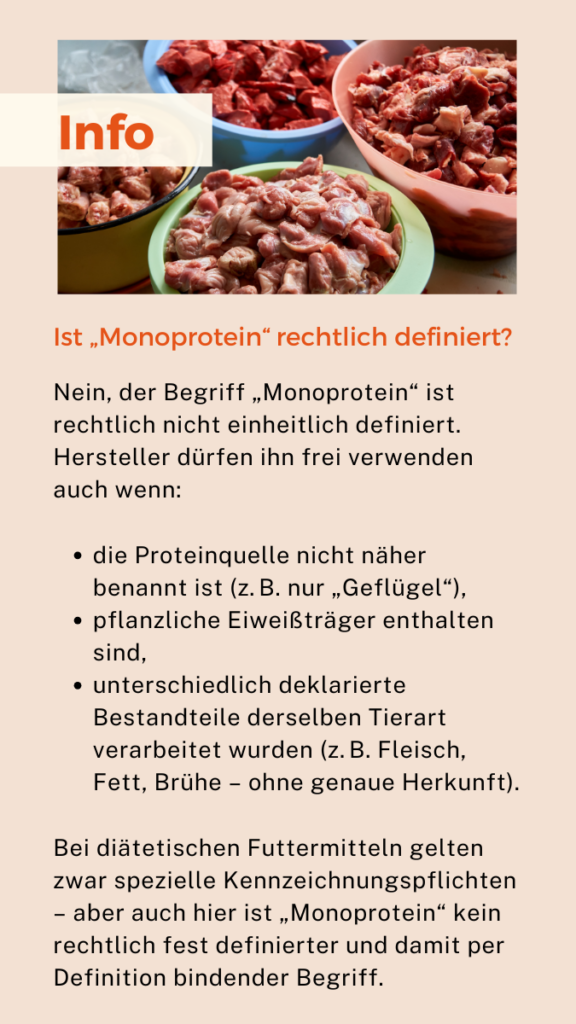
Entscheidend ist nicht die Zahl der Tierarten, sondern:
Wie transparent sind die Zutaten deklariert?
Bei Fertigfuttern mit mehreren Proteinquellen ist eine möglichst offene Deklaration der tierischen Bestandteile besonders wichtig. Wenn klar ersichtlich ist, was genau enthalten ist – z. B. Huhn, Pute und Rind, ist das Futter nicht grundsätzlich schlechter zu bewerten als ein Monoprotein-Futter.
Problematisch wird es nur, wenn pauschal von „Fleisch und tierischen Nebenerzeugnissen“ ohne genauere Bezeichnungen die Rede ist. Denn dann weiß niemand, was und welche Proteinquelle da im Napf landet und im Fall einer Unverträglichkeit ist keinerlei Rückverfolgung möglich.
Wie ist das Futter insgesamt zusammengesetzt?
Ein sinnvoll kombiniertes Produkt mit zwei oder drei klar deklarierten Proteinquellen kann ernährungsphysiologisch sogar Vorteile bringen – etwa durch eine bessere Aminosäurebilanz. Hier zählt der Blick aufs Ganze. Davon mal abgesehen, dass es auch Monoprotein-Sorten gibt, die ich niemals füttern würde: Monoprotein nutzt überhaupt nichts, wenn das, was vom Tier verarbeitet wurde, ausschließlich schlecht verdauliche Bindegebe oder problematische Futterbestandteile wie Kehlköpfe sind.
Und beim BARFen?
Auch beim Barfen kursiert manchmal die Idee, dass alles in einer Mahlzeit von einer einzigen Tierart stammen müsse – also z. B. ausschließlich Rind oder ausschließlich Huhn. Doch auch hier gilt: Nicht die Einheitlichkeit der Tierart ist entscheidend, sondern die Verträglichkeit und Sinnhaftigkeit der gewählten Zutaten.
Es ist völlig in Ordnung, Rinderniere, Hühnerhälse und Putenmuskelfleisch in einer Fütterung zu kombinieren. Vorausgesetzt, gegen keine dieser Komponenten bestehen bekannte Reaktionen.
Denn beim Barfen kennt man in der Regel jede einzelne Zutat, die genutzt wird. Man wählt bewusst aus, gestaltet individuell und hat dadurch ohnehin eine hohe Kontrolle über die Zusammensetzung der Ration.
Vor allem in der Anfangszeit – z. B. bei Welpen – kann es trotzdem sinnvoll sein, die Zahl der eingesetzten Tierarten überschaubar zu halten. Mehr als 3 bis maximal 4 verschiedene Tierarten zu füttern, ist weder für Welpen noch für adulte Hunde und Katzen notwendig, noch ist es sinnvoll. Bei Welpen sind vor allem die ersten Wochen nach dem Absetzen wichtig, also der Zeitraum, in dem sie von der Muttermilch auf feste Nahrung wechseln. Gerade in diesem Zeitraum ist es tatsächlich zur Unterstützung von Immunsystem / Darm sehr sinnvoll, die Fütterung schrittweise aufzubauen und nicht alles wild durcheinander zu füttern. Aber leider läuft es genau so: Welpen lernen in kurzer Zeit sehr viele verschiedene Proteine und Futterbestandteile kennen.
Besonders paradox in der Welpenfütterung
Während viele sich aus Unsicherheit gegenüber dem Barfen für Fertigfuttere entscheiden, erhalten Welpen dann häufig ein industrielles Alleinfutter mit über 20 (oft mehr!) Inhaltsstoffen – oft ohne klare Angabe, was genau enthalten ist.
Dabei wäre gerade im Welpenalter eine reduzierte, nachvollziehbare Fütterung sinnvoll: Zum Aufbau der Darmflora, für eine problemlose Verdauung und zur langfristigen Stabilität der Immunantwort.
Monoprotein ist auch beim Barfen also kein Muss.
Was zählt, ist Qualität, Klarheit und die bewusste Wahl der Zutaten – nicht ihre Einheitlichkeit im Napf.
Fazit
Monoprotein ist weder gut noch schlecht, es ist ein Konzept. Manchmal ist es auch nichts anders als Matketing, um weniger gut zusammengesetzte Futtersorten aufzuwerten. Wie bei jedem Konzept kommt es auf den Kontext an. Richtig eingesetzt, kann es helfen, Klarheit in komplexe Fälle zu bringen oder sensiblen Tieren eine stabile Grundlage zu bieten. Falsch verstanden, führt es zu falscher Sicherheit oder unnötiger Komplexität, weil man sich wieder um eine Sache mehr in der Fütterung Gedanken macht, die vielleicht für das eigene Tier gar nicht wichtig ist.
Wenn Du deinen Hund oder deine Katze möglichst verträglich und bedarfsgerecht füttern möchtest, geht es wie immer darum, sich nicht von Schlagworten oder geschicktem Marketing leiten zu lassen. Wie immer geht es eigentlich nur darum, was Dein Hund oder Deine Katze benötigt, welche Bedarfssituation gerade vorliegt und wie Du Dein Tier so hochwertig wie möglich versorgen kannst.








Schreibe einen Kommentar